|
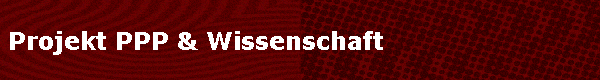 |
|
|
PPP zwischen Theorie und Praxis Konzeptionelle Überlegungen zur Zusammenarbeit mit der Wissenschaft* Public-Private Partnership der GTZ Hintergrund und Themen Da sich nach Abschluss der ersten Phase (1999-2001) der GTZ einige konkrete Fragen stellen, die mit Hilfe einer laufenden Wirkungsbeobachtung nur teilweise beantwortet werden können, bietet es sich an, eine koordinierte Kooperation mit dem Wissenschaftsbereich anzustreben. Dies geschieht institutionalisiert über einen Ansprechpartner im PPP-Büro, der verantwortlich für den Bereich Monitoring & Evaluierung/Controllling ist (Raimund Riefenstahl). Als „externe Werkbank“ wurde ein Consultant (Sebastian Meurer) beauftragt. Folgende Schwerpunkte sollen dabei gesetzt werden:
Die bis Ende 2002 abgeschlossene BMZ-Querschnittsevaluierung ist die Basis bei der Auswahl von Themen und für die Weiterentwicklung des PPP-Programms. Eine weitere Grundlage sind die Ergebnisse aus M&E sowie dem Wissensmanagement. Hierzu wurde im Oktober 2002 ein zusammenfassender Synthesenbericht „Wirkungen und Nebenwirkungen der PPP-Fazilitäten“ erstellt, der die bisherigen PPP-Erfahrungen der GTZ aufbereitet. Angebot und Möglichkeiten Die GTZ könnte beispielsweise entsprechenden wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. Studierenden, die sich im Rahmen einer Seminararbeit bzw. Studienabschlussarbeit mit dem Thema PPP auseinandersetzen wollen, Projektunterlagen zur Verfügung stellen. Diese könnten – mit gegenseitigem Vertrauensschutz natürlich – Ausgangspunkt für die Forschung sein. Ferner unterhält die GTZ zum Monitoring der PPP-Maßnahmen eine Datenbank die fortwährend aktualisiert wird. Diese Datenbank ermöglicht beispielsweise die Erstellung aktueller Portfolioanalysen zu Sektoren, Regionen, Durchführungsstand und Finanzen des PPP-Programms der GTZ. Ferner könnte die GTZ das PPP-Management-Know-how zur Verfügung stellen, d.h. Kontakte zu verantwortlichen PPP-Projektmanagern in der Zentrale bzw. vor Ort vermitteln. Neben diesen Kernressourcen könnten PPP erfahrene Referenten für Seminare und Tagungen abgestellt werden, bzw. individuelle Hilfestellungen geleistet werden. Der Wissenschaftsbereich hingegen stellt sein wissenschaftliches Know-how (Theorien, „Werkzeuge“ [z.B. empirische Sozialforschung]) in Form von Personen und Zeit zur Verfügung. Ferner könnten über weitere Kontakte oder über den Aufbau eines PPP-Netzwerkes die entsprechenden und interessantesten Themen diskutiert werden. Schließlich soll es darum gehen, dass die Wissenschaft als externer Akteur der GTZ Antworten und Handlungsempfehlungen auf offene Fragen zum Thema PPP liefert. |
|
Sie haben Ideen, Anregungen, Kritikpunkte? Teilen Sie diese mir mit! Contact hier |
|
*diese Darstellung spiegelt eine persönliche Meinung wider aus der sich keinerlei rechtlichen Verpflichtungen seitens der angesprochenen Institutionen ergeben |
|
|






