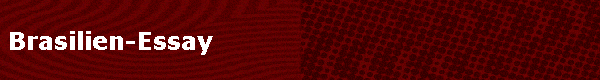
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Basisdaten
Fläche: 8,5 Mio. qkm
Einwohner: 173 Mio.
Bevölkerungsdichte: 19,8 Einwohner/qkm
Bevölkerungswachstum: 1,63% p.a.
Alphabetenrate: 86,7%
BIP: US$ 500 Mrd. (2001)
BIP/Kopf: US$ 2.890,- (2001)
Arbeitslosigkeit: 6,5% (2002 S.Paulo)
Währung: Real (seit 1.7.94, EUR 1,- = R$ 3,06)
Mindestlohn: R$ 200,-/Monat (April 2002)
DFI: US$ 17 Mrd. (2002)
AuĂźenverschuldung: US$ 288 Mrd. (2002)
Saldo Handel mit Deutschland: DM -1.623 Mio.
FZ: EUR 694,4 Mio.
TZ: EUR 426,3 Mio.
Föderale Republik
Hauptstadt BrasĂlia
Präsident: Luis Inácio Lula da Silva (seit 1.1.2003)
Daten aus:
Institut fĂĽr Brasilienkunde Brasilien-Kalender 2003
Brasilien – Land der Zukunft?
Eine Zusammenfassung ĂĽber die wichtigsten Daten des Landes
von Sebastian Meurer, M.A.
Brasilien wird in der mittlerweile weltbekannten Monographie des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig “Brasilien – Ein Land der Zukunft” treffend charakterisiert:
“Europa hat unermeßlich mehr Tradition und weniger Zukunft, Brasilien weniger Vergangenheit und mehr Zukunft!” [Zweig 1981]
Trotzdem feierte Brasilien am 22. April 2000 groß das 500jährige Jubiläum der Besitznahme des Landes durch den portugiesischen Seefahrer Alvares Cabral in Porto Seguro, einem Küstenort ca. 1.000 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro im Bundesstaat Bahia. Diese Feiern, begleitet von Protesten verschiedenster Gruppen, erinnerten an die Ankunft Cabrals in Brasilien vor 500 Jahren [Neue Zürcher Zeitung 2000].
 Möchte man brasilianische Kultur heute annähernd verstehen, so ist es
notwendig, einen Blick auf die brasilianische Geschichte zu werfen. Brasilianische Kultur ist demnach weniger eine Gesamtsumme verschiedener Kulturen, die Ende des 16 Jahrhunderts koexistierten als Cabral Brasilien
“entdeckte”, sondern vielmehr ein zufälliges Ergebnis der Kolonialgeschichte, eines “Melting Pot Cultural” [Gazeta do Sul 2000]. Entstanden ist diese
Kulturvermischung durch die Auswanderer aus Europa – hier vor allem aus Portugal, Spanien, Frankreich und Deutschland [Gazeta Grupo de Comunicações 2000] – Sklaven aus Afrika und den indianischen Ureinwohnern
[Gazeta do Sul 2000].
Möchte man brasilianische Kultur heute annähernd verstehen, so ist es
notwendig, einen Blick auf die brasilianische Geschichte zu werfen. Brasilianische Kultur ist demnach weniger eine Gesamtsumme verschiedener Kulturen, die Ende des 16 Jahrhunderts koexistierten als Cabral Brasilien
“entdeckte”, sondern vielmehr ein zufälliges Ergebnis der Kolonialgeschichte, eines “Melting Pot Cultural” [Gazeta do Sul 2000]. Entstanden ist diese
Kulturvermischung durch die Auswanderer aus Europa – hier vor allem aus Portugal, Spanien, Frankreich und Deutschland [Gazeta Grupo de Comunicações 2000] – Sklaven aus Afrika und den indianischen Ureinwohnern
[Gazeta do Sul 2000].
Goerdeler bezeichnet Brasilien als ein “geschichtsloses Land” [Goerdeler 2000], das weder einem Mythos von Gottkaisertum oder dem einer “Grande Nation” unterlegen ist, noch Kriege geführt hat. Ein Land, das sehr verschieden ist, aber doch eine Einheit besitzt. Goerdeler beschreibt treffend diese Einheit anhand der Liebe zum Fußball:
“Von Oiapoque bis Chui - alles Brasilianier, 165 Millionen. Mögen sie Fernando Henrique Cardoso, Tizuka Yamasaki, Hitler Mussolini da Silva oder Dietmar Starke heissen, sich als Yanomami oder Yuppi geben, mit dem Einbaum oder dem Auto zur Arbeit fahren, braune, gelbe, schwarze oder weisse Haut haben. Allesamt sind sie vierfache Fussballweltmeister. Das verbindet das zählt.” [Goerdeler 2002]
In Brasilien leben ca. 174 Mio. Einwohner [IBGE 2002] und ist mit einer Fläche von 8,5 Mio. Quadratkilometern das fĂĽnftgrößte Land der Welt. Brasiliens Hauptstadt ist seit 1961 BrasĂlia, weitere wichtige Städte sind SĂŁo Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife und Fortaleza. Brasilien ist Mitglied in diversen WirtschaftszusammenschlĂĽssen, unter anderen dem MERCOSUL, einem gemeinsamen Markt zwischen Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay [Institut fĂĽr Brasilienkunde 2000].
 Brasiliens Wirtschaft gehört zu den zehn grössten Wirtschaften
der Welt, und im Jahr 2001 wurde ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 502,4 Mrd. US$ erwirtschaftet. Pro Kopf wurde ein BIP von 2.915,- US$ in der “Länderanalyse Brasilien” des F.A.Z.-Institutes
errechnet [F.A.Z.-Institut 2002]. Zur Veranschaulichung merkt Hartmut Sangmeister an:
Brasiliens Wirtschaft gehört zu den zehn grössten Wirtschaften
der Welt, und im Jahr 2001 wurde ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 502,4 Mrd. US$ erwirtschaftet. Pro Kopf wurde ein BIP von 2.915,- US$ in der “Länderanalyse Brasilien” des F.A.Z.-Institutes
errechnet [F.A.Z.-Institut 2002]. Zur Veranschaulichung merkt Hartmut Sangmeister an:
“Das brasilianische BIP übersteigt die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung aller Staaten des mittleren Ostens und Nordafrikas zusammengenommen; sämtliche afrikanische Volkswirtschaften südlich der Sahara erwirtschaften zusammen lediglich 40 % des brasilianischen BIP.” [Sangmeister 1994]
Die Weltbank ordnet Brasilien aufgrund seines BIP pro Kopf in die Gruppe der Länder mit gehobenem Einkommen zu, in der sich auch Länder wie Südafrika, Portugal und Südkorea befinden (Sangmeister 1994). Das Einkommen in Brasilien ist allerdings sehr ungleich verteilt. 50 % des nationalen Einkommens sind auf 10 % der Gesamtbevölkerung verteilt, “doppelt soviel wie im internationalen Durchschnitt” [Lacerda 2000]. Brasilien ist ein von Unterschieden und Gegensätzen geprägtes Land – trotz vieler Gemeinsamkeiten gibt es High-Tech-Industrie und moderne Banken in São Paulo ebenso, wie Paranussknacker in Amazonien oder Kleinbauern im Nordosten.
 Im Bericht über die “Menschliche Entwicklung” der Vereinten Nationen wird Brasilien einerseits
eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation attestiert, andererseits im Bereich der sozialen Entwicklung gravierende Mängel festgestellt [Folha de São Paulo 2000]. Das BIP pro
Einwohner stieg beispielsweise bis auf 6.625,- US$ im Jahr 1998, und es verbesserte sich die die Zahl der Telefonlinien (von 65 pro 1000 Einwohner im Jahr 1990 auf 121 pro 1000 Einwohner im
Jahr 1996/98), Fernsehgeräte (von 213 pro 1000 Einwohner 1990 auf 316 pro 1000 Einwohner 1996/98) und Personal Computer (von 3 pro 1000 Einwohner 1990 auf 30 pro 1000 Einwohner
1996/98). Auf der anderen Seite wurde keine gravierende Verbesserung bei den sozialen Indikatoren, wie Alphabetisierung, Säuglingssterblichkeit, Lebenserwertung, und Urbanisierung
erreicht. Die Vereinten Nationen zählten im Jahr 1998 50,1 Millionen Brasilianer, die in Armut leben, das entspricht 32,7% der Gesamtbevölkerung.
Im Bericht über die “Menschliche Entwicklung” der Vereinten Nationen wird Brasilien einerseits
eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation attestiert, andererseits im Bereich der sozialen Entwicklung gravierende Mängel festgestellt [Folha de São Paulo 2000]. Das BIP pro
Einwohner stieg beispielsweise bis auf 6.625,- US$ im Jahr 1998, und es verbesserte sich die die Zahl der Telefonlinien (von 65 pro 1000 Einwohner im Jahr 1990 auf 121 pro 1000 Einwohner im
Jahr 1996/98), Fernsehgeräte (von 213 pro 1000 Einwohner 1990 auf 316 pro 1000 Einwohner 1996/98) und Personal Computer (von 3 pro 1000 Einwohner 1990 auf 30 pro 1000 Einwohner
1996/98). Auf der anderen Seite wurde keine gravierende Verbesserung bei den sozialen Indikatoren, wie Alphabetisierung, Säuglingssterblichkeit, Lebenserwertung, und Urbanisierung
erreicht. Die Vereinten Nationen zählten im Jahr 1998 50,1 Millionen Brasilianer, die in Armut leben, das entspricht 32,7% der Gesamtbevölkerung.
Im “Human Development Index” (HDI), der auch diese Sozialindikatoren berücksichtigt, liegt Brasilien auf Rang 74 von 174 Ländern, vor Staaten wie Saudi-Arabien, Thailand und den Philipinen, aber hinter Ländern wie Kasachstan, Libien, Georgien oder Surinam [Folha de São Paulo 2000]. Ferner ist die Erwirtschaftung des BIP regional sehr unterschiedlich. Während einerseits der Nordosten beim HDI-Ranking zwischen Ländern wie Uganda und Äthiopien platziert ist, findet sich der Südbundesstaat Rio Grande do Sul zwischen Ländern wie Griechenland und Hong Kong wieder [Sangmeister 1994].
Insgesamt ist Brasilien ein rohstoffreiches Land und exportiert Soja, Kaffee, Orangen, Kakao, Reis als agrarische Rohstoffe sowie Erdöl, Erdgas, Bauxit, Uran und Kohle als mineralische Rohstoffe [Institut für Brasilienkunde 2000]. Der wirtschaftliche Austausch mit Deutschland ist rege: Deutsche Exporte nach Brasilien legten 2001 um 13,1% auf 5,7 Mrd. EUR zu, was vor allem an einer gestiegenen Nachfrage nach Investitionsgütern zurückzuführen ist. Deutsche Importe aus Brasilien wurden im Jahr 2001 in der Größenordnung von 3,9 Mrd. EUR getätigt, ein geringfügiger Anstieg von 1,2% gegenüber dem Vorjahr. Deutschland ist damit der drittwichstigste Import- und vierwichtigste Exporthandelspartner [F.A.Z.-Institut 2002].
Brasilien wird seit Januar 1995 von Fernando Henrique Cardoso regiert. Seine grösste politische Leistung war es, noch als Wirtschaftminister unter seinem Vorgänger im Präsidentenamt Itamar Franco, mit dem Stabilitätsprogramm “Plano Real” das große Problem der Inflation “über Nacht zu lösen” [Fritz 1996]. Litt Brasilien in den achtziger und Anfang der neunziger Jahre von jährlichen Inflationsraten bis zu 2.491 % (1993), so lag die Inflationsrate bei 6,8% im Jahresschnitt 2001 [F.A.Z.-Institut 2002]. Möglich wurde dieser Kraftakt nur durch drastische wirtschaftspolitische Maßnahmen: Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen, sowie eine Hochzinspolitik waren ebenso zu zahlender Preis, wie die Ausweitung der Binnenverschuldung von 153 Mrd. Reais auf 356 Mrd. Reais, sowie eine Verdoppelung des Anteiles des Haushaltsdefizits am BIP von 4,6% auf 8%. Cardoso wird vorgeworfen, die notwendigen finanziellen Korrekturen, beispielsweise die Kürzung der fürstlichen Beamtenpensionen, nicht vorgenommen zu haben [Goerdeler 1998]. Folge seiner neoliberalen Politik war ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit sowie höhere Lebenshaltungskosten [Fritz 1996], seit Januar 1995 bis zum März 2002 stiegen beispielsweise die sogenannten „administrativen Kosten“, dazu zählt man unter anderen Telefon, Strom, Wasser/ Abwasser, Treibstoffe, öffentlicher Transport, durchschnittlich um 180%. Allein die Wohnungsmieten stiegen um 485%, Festtelefon 445%, Gas (in Flaschen) 324%, Benzin 188% (hier ist nochmals ein Anstieg seit Jahresbeginn 2002 von 35% feststellbar) etc. [Klam 2002]. Ferner wird Cardoso vorgehalten, anstatt notwendige Investitionen im Bildungs- und Gesundheitswesen vorzunehmen, eher den Schuldendienst der brasilianischen Auslandsschulden beim Internationalen Währungsfond (IWF) bedient [Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 1999].
Trotzdem wurde Cardoso bei den Präsidentschaftswahlen vom Oktober 1998 mit 53% der abgegebenen Stimmen im ersten Wahlgang wiedergewählt. Es votierten sogar 1,6 Mio. Wahlberechtigte mehr für ihn im Vergleich zu den Wahlen von 1994 [Institut für Brasilienkunde 2000]. Eine wirtschaftliche Krise in der ersten Jahreshälfte 1999 – durch eine Währungsabwertung im Gefolge einer Wechselkursfreigabe wurde unter anderen die Produktion paralysiert – konnte recht schnell überwunden werden, und die veröffentlichten Angaben zur Entwicklung des BIP unterstrichen eine positive wirtschaftliche Entwicklung [Neue Zürcher Zeitung 20002].
Die gegen Ende 2000 einsetzende Rezession in den USA, Europa und Japan – verstärkt im Jahr 2001 nicht zuletzt durch die Ereignisse des 11. September – ließ jedoch Brasilien nicht unberührt. Hinzu kam eine außerordentlich ernste Energiekrise, die die Wirtschaft und die Haushalte zwang, den Stromverbrauch um 20% zu drosseln (im Vergleich zum Vorjahrsbedarf), was insgesamt trotz erheblicher makroökonomischer Konsequenzen (der Leitzinssatz, der im März 2001 auf 15,25% reduziert werden konnte, stieg im Juli 2001 auf 19% an und blieb im Jahresschnitt 2001 bei diesem Wert) positive Auswirkungen auf das Energiesparverhalten hatte. So blieb es nach dem Ende der staatlich verordneten Rationalisierungsmassnahmen Ende Februar 2002 bei 7-12 % Energieverbrauchseinsparung [Klam 2002]. Hinzu kommt, daß Brasilien – neben der gravierenden wirtschaftlichen und politischen Krise des Nachbarn Argentinien – unter einer großen politischen Unsicherheit zu leiden hat.
 Cardoso konnte verfassungsgemäß nicht wieder
für das Präsidentenamt kandidieren und im zweiten Wahlgang am 27. Oktober 2002 setzte sich der bekannte ehemalige Gewerkschaftsführer Luis Inacio Lula da Silva von der Arbeiterpartei (PT) mit 52,8 Mio.
Stimmen (61,27%) gegen den Regierungskandidaten, den ehemaligen Gesundheitsminister und Senator des Bundesstaates São Paulo, José Serra
(PSDB), durch. Brasiliens Wählerinnen und Wähler haben damit erstmals in der Geschichte des Landes der traditionellen Elite eine Absage gegegben [Hofmeister 2002]. Lula, der “weichgespülte Rebell” [Burghardt 2002],
steht wie niemand anders fĂĽr diejenigen Schichten, die bisher von der politischen Macht weitgehend ausgeschlossen blieben: die einfachen Arbeiter und die Millionen Brasilianer die in Elend und Armut leben mĂĽssen.
Der Wechsel weckt Hoffnungen für Reformen, die eine Verbesserung der Lebensverhältnisse, Arbeitsplätze, die Überwindung von Armut und Hunger, die Verbesserung im Schul- und Gesundheitswesen und die Fortschritte in
vielen anderen Bereichen hervorbringen sollen. Lula steht vor einer “Herkulesaufgabe” und der Spielraum für diese
Reformen ist durch die Mehrheit im Kongress – wo Lulas PT kaum mehr al ein fünftel der Sitze stellt – durch finanzpolitische Zusagen gegenüber dem Internationalen Währungsfond (IWF) sowie durch die schlimme finanzielle
Situation der öffentlichen Haushalte und der brasilianischen Volkswirtschaft sehr eingeschränkt.
Cardoso konnte verfassungsgemäß nicht wieder
für das Präsidentenamt kandidieren und im zweiten Wahlgang am 27. Oktober 2002 setzte sich der bekannte ehemalige Gewerkschaftsführer Luis Inacio Lula da Silva von der Arbeiterpartei (PT) mit 52,8 Mio.
Stimmen (61,27%) gegen den Regierungskandidaten, den ehemaligen Gesundheitsminister und Senator des Bundesstaates São Paulo, José Serra
(PSDB), durch. Brasiliens Wählerinnen und Wähler haben damit erstmals in der Geschichte des Landes der traditionellen Elite eine Absage gegegben [Hofmeister 2002]. Lula, der “weichgespülte Rebell” [Burghardt 2002],
steht wie niemand anders fĂĽr diejenigen Schichten, die bisher von der politischen Macht weitgehend ausgeschlossen blieben: die einfachen Arbeiter und die Millionen Brasilianer die in Elend und Armut leben mĂĽssen.
Der Wechsel weckt Hoffnungen für Reformen, die eine Verbesserung der Lebensverhältnisse, Arbeitsplätze, die Überwindung von Armut und Hunger, die Verbesserung im Schul- und Gesundheitswesen und die Fortschritte in
vielen anderen Bereichen hervorbringen sollen. Lula steht vor einer “Herkulesaufgabe” und der Spielraum für diese
Reformen ist durch die Mehrheit im Kongress – wo Lulas PT kaum mehr al ein fünftel der Sitze stellt – durch finanzpolitische Zusagen gegenüber dem Internationalen Währungsfond (IWF) sowie durch die schlimme finanzielle
Situation der öffentlichen Haushalte und der brasilianischen Volkswirtschaft sehr eingeschränkt.
Literatur
Burghardt, Peter: Hoffen auf den wichgespülten Rebellen. Lula Inacio da Silva versucht im vierten Anlauf, das Präsidentenamt zu erringen – der Sieg ist ihm kaum noch zu nehmen. In: Süddeutsche Zeitung vom 05./06. Oktober 2002. S. 9.
Conselho Nacional de Igrejas CristĂŁs do Brasil (Hrsg.): ABC da DĂvida Externa. A vida antes que a dĂvida. BrasĂlia 1999.
Folha de SĂŁo Paulo (Hrsg.): Sai relatĂłrio 2000 da situação econĂ´mia e social em 174 paĂses. Cobertor curto. Sonderbeilage vom 29. Juni 2000.
Fritz, Barbara: Wie leicht ist es, Brasilien zu regieren. Länderbericht Brasilien. In: Gabbert, Karin: Offene Rechnungen. Lateinamerika. Band 20. Bad Honnef 1996.
Gazeta do Sul (Hrsg.): 500 Anos do Descobrimento do Brasil. Zeitungsbeilage vom 22. April 2000. S. 20.
Gazeta Grupo de Comunicações (Hrsg.): Alemães. Uma etnia para a integração. Os 150 anos da imigração em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul 2000.
Goerdeler, Carl D.: Andere Länder – andere Sitten. Kulturschock Brasilien. Bielefeld 2002.
Goerdeler, Carl D.: Das Spiel, das zählt. Ein Geschichtsjubiläum in einem geschichtslosen Land. In: Neue Zürcher Zeitung. Internationale Ausgabe. Nr. 95 vom 22. April 2000.
Goerdeler, Carl D.: Schwerer Start. Nur mit internationaler Hilfe kann Brasilien seine Finanzprobleme bewältigen. In: Die Zeit. Hamburg. Nr. 42 vom 8. Oktober 1998.
Hofmeister, Wilhelm: Die Hoffnung besiegt die Angst. Brasilien wählt den Wandel. In: <http://www.adenauer.com.br> vom 2. November 2002,
Institut fĂĽr Brasilienkunde (Hrsg.): Brasilien-Kalender 1999. Mettingen 2000. S 1 ff. (kĂĽnftig zitiert als: IfB: Brasilien 1999).
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica <http://www.ibge.gov.br/> (vom 04. Juli 2002)
Klam, Peter: Brasilien heute. Wirtschaftspolitische Analyse (laufend aktualisiert). In: <http://www.ahk.com.br> vom 20.09.2002
Lacerda, AntĂ´nio CorrĂŞa de: Einkommenskonzentration und Entwicklung. <http://www.ahkbrasil.com/rev0598ahtm> vom 17. August 2000.
Neue ZĂĽrcher Zeitung (Hrsg.): Attraktiver Konjunkturverlauf in Brasilien. Internationale Ausgabe. Nr. 186 vom 12. August 20002. S. 22.
Neue ZĂĽrcher Zeitung (Hrsg.): Proteste begleiten die 500-Jahr-Feier in Brasilien. Internationale Ausgabe. Nr. 96 vom 25. April 2000. S. 7.
Neue Zürcher Zeitung (Hrsg.): Wahlgewinne für die Linke in Brasilien. Lula und Serra in der Stichwahl der Präsidentschaft. Internationale Ausgabe vom 8. Oktober 2002.
Sangmeister, Hartmut: Zwischen Binnenmarktorientierung und Weltmarktorientierung. Probleme der brasilianischen Volkswirtschaft. In: Briesemeier, Dieter et al: Brasilien heute. Politik - Wirtschaft - Kultur. Frankfurt am Main 1994.
Zweig, Stefan: Brasilien – Ein Land der Zukunft. Mit farbigen Fotografien und einem Nachwort von Volker Michels. Frankfurt am Main 1981.
[Home] [PPP] [Wissenschaft] [Interkulturell] [Brasilien] [Personal]
[Contact meuseb@meuseb.de copyright by Sebastian Meurer 2003]